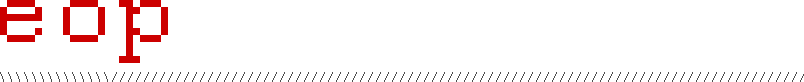Rezension: Christian Baier: romantiker. Wien 2006.
Rebecca Schönsee
Was bleibt in einer Welt der Verflüssigungen für das Ich übrig? Ein anderes „Ich“, um dieses zu verletzen, sich daran abzuarbeiten, sich „aufzuladen“, verletzt zu werden und durch die Wunde ein Selbst zu finden, oder besser: Selbst zu schrei(b)en. Christian Baiers wohl durchkomponiertes Werk „romantiker“ lässt kein ästhetisches Bild zeitgenössischer Kunst aus, um den Leser durch eine Welt des Zerfalls zu leiten, in der alles zum Simulacrum erstarrt ist, jede Handlung hohle Performanz wird.
In der voyeuristischen Betrachtung Sterbender versuchen die zwei anonymen Protagonisten, ein männliches Ich und seine Anima (sie) ihre jeweiligen Traumata, den Tod des jeweiligen Partners und damit ihren individuellen „Familienroman“, im Falle der weiblichen Seite, das inzestuöse Verhältnis zum Vater, im Falle des Erzählers den Tod der Partnerin Anna, zu bewältigen. Nachdem ihre Beobachtung nichts weiter auslöst als eine Ästhetik des Ekels und die erhoffte kathartische Wirkung ausbleibt, wenden die beiden Protagonisten sich gegenseitig zu, um in der physischen Begegnung das Geheimnis des Anderen zu entbergen oder im Sinne Derridas die Spur des Ich aufzunehmen.
„romantiker“ wird zu einem Partnerschaftsspiel mit klassischer symmetrischer Eskalation, bei dem am Ende Watzlawicks Temperaturregler seinen Geist aufgibt: Man verbringt einen Samstag miteinander („wie man ihn verbringt“, Frühstück, einkaufen, Flohmarkt, Kino) und drängt Stück für Stück das Gegenüber in die Rolle des verflossenen Partners. So wird das „Du“ zur Ladebatterie für die Wunden der Vergangenheit. An einer zentralen Stelle heißt es: „Ich lud mich an ihr auf. Sie war wie ein siedend heißer Tropfen, der auf eine dicke Eisdecke fällt und sie zum Schmelzen bringt. Ich weiß, ich weiß, das ist ein blödes Bild. Total romantisch…“ – so „romantisch“, dass es sich im Ende verkehrt, wenn “sie“ „ihm“ jene Wunde zufügt, die ihr der strafende Vater als Signé auf den Körper geschrieben hat, nämlich eine Verbrennung durch ein Bügeleisen. Das gebrannte Kind brennt sich nun selbst in sadistischer Lust dem Geliebten ein: „das Bild, das letzte, das ich sah – das letzte Bild: SIE sich auflöste in [m]einem Schrei“ – Es bleibt offen, in welcher Weise und ob das Bügeleisen Animus und Anima seine Traumata ausbügelt oder ob die berühmte Falte auch jenseits der Metaebene der Lektüre sichtbar bleibt. Der Leser jedenfalls faltet nach dem Schlusstableau des Schreis ein Werk zusammen, das gekonnt metatextuell einen Assoziationsraum eröffnet, der die Diskurse der Gegenwart einsaugt. Sie erscheinen als ähnlich romantisch-morbides Gesellschaftsspiel wie das Spiel der Protagonisten. Bleiben jene gefangen in der Selbstbespiegelung des anderen, sind es diese im Gewebe der Metaphern. Auf fast paradoxe Weise entleert Baier in seiner Novelle so jene aufgeladenen Vokabeln der Postmoderne, die dekonstruktivistische „Spur“ (Derrida), die poststrukturalistische „Falte“ (Deleuze), oder die Philosophie des Anderen (Levinas). Sie wirken vor der Folie der „romantiker“ banal, so dass schließlich jener Satz die Nagelprobe besteht, die das Buch auf ihn anwendet, nämlich, „dass das Banale die Schnittstelle ist zwischen Kunst und Wirklichkeit“ – im Textgewebe Baiers ist alles Kunst und Wirklichkeit nichts als ein romantisches Konzept, das sich zur Kunst ausfranst, bis beides als geschriebener Schrei im Leser verklingt. Es klingt schrecklich gut.
© Rebecca Schönsee, 2006.